Wenn das System überfordert ist, nimmt das Kind schaden
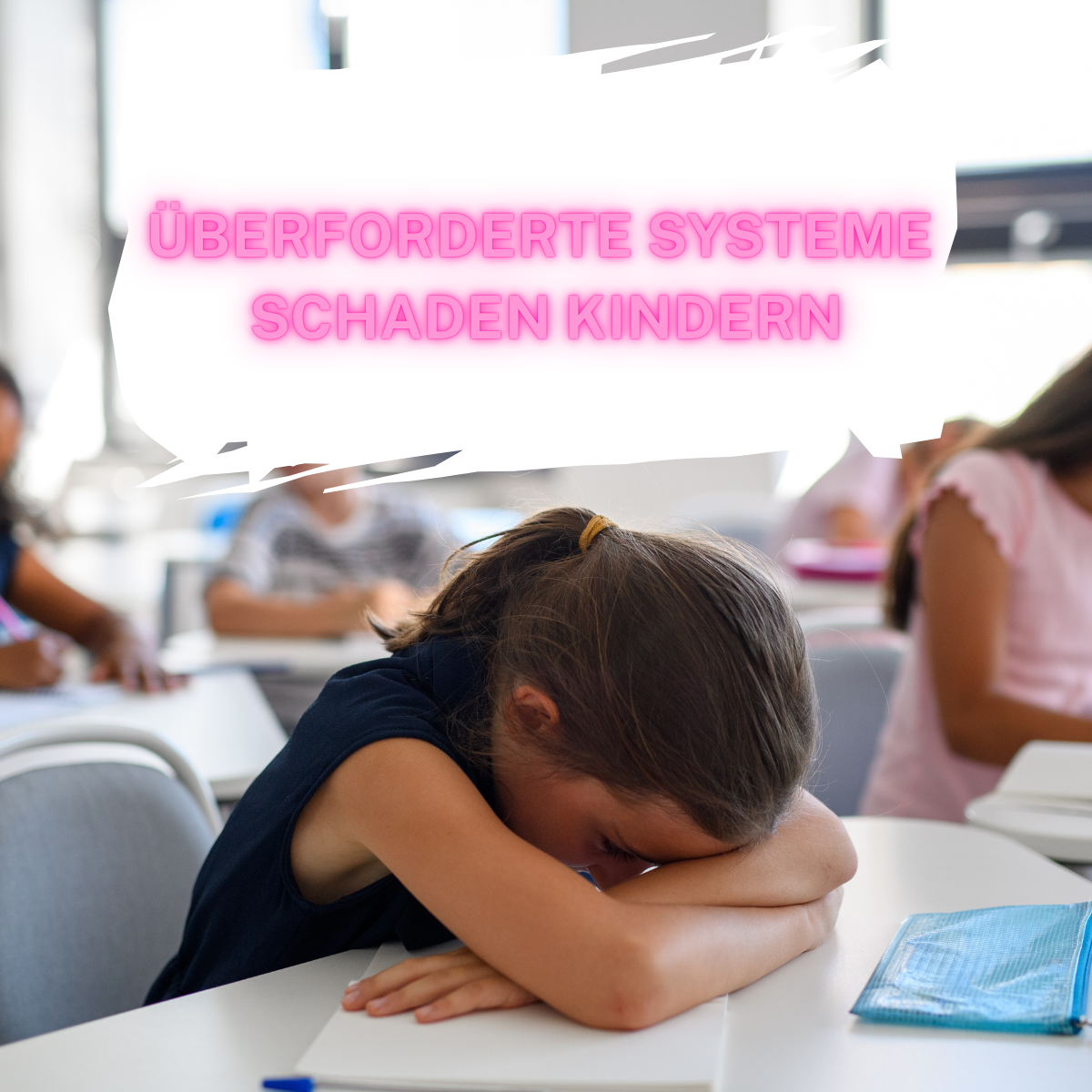
Warum Regelschulen Neurodivergenz endlich verstehen müssen.
Viele Regelschulen sind nicht „schlecht“ – sie sind überfordert.
Weil sie etwas leisten sollen, wofür ihnen das Wissen, die Strukturen und manchmal auch die innere Kapazität fehlen. Doch solange wir das nicht ehrlich benennen, bleibt der Druck – und die Schuld – bei den Kindern.
Regelschulen, die kaum Wissen über das autonome Nervensystem oder über Neurodivergenz haben, sind im Alltag schnell überfordert. Nicht, weil Lehrkräfte „nicht wollen“. Sondern weil sie auf etwas reagieren, das sie nie gelernt haben zu verstehen.
Wenn Kinder im Unterricht nicht „funktionieren“, wird ihr Verhalten häufig pathologisiert und negativ bewertet: Zu laut. Zu unruhig. Zu auffällig. Zu empfindlich. Zu wenig angepasst. Zu anstrengend.
Sanktioniert wird dann oft mit Methoden aus der Operanten Konditionierung: Verhaltensampeln, Strafarbeiten, Entzug von Pausen, Beschämung vor der Klasse, Ausschluss aus Gruppenausflügen oder zeitweise Ausgrenzung aus der Klassengemeinschaft.
Maßnahmen, die kurzfristig Kontrolle herstellen sollen, aber langfristig die Scham, den Stress und die Dysregulation verstärken.
Dabei wären genau diese Kinder diejenigen, die Verständnis, Sicherheit und Co-Regulation bräuchten.
Fehlendes Wissen – fatale Folgen
Wer das Nervensystem nicht versteht, kann Verhalten nicht richtig einordnen.
Dann werden Meltdowns zu „Wutausbrüchen“, Rückzug zu „Träumerei“ und Reizüberflutung zu „Unaufmerksamkeit“. Es wird sanktioniert und abgewertet, statt unterstützt, co-reguliert und nachhaltig gefördert.
Das Credo: Kontrolle, statt Co-Regulation. Konformitätsdruck, statt Zugehörigkeit.
Und wenn PädagogInnen an ihre eigenen Grenzen kommen - weil das Wissen fehlt, sie chronisch gestresst sind, destruktive Glaubenssätze, Konzepte und Kompensationsstrategien haben - passiert oft das, was zwar sehr menschlich ist, aber auch sehr destruktiv: Das Kind oder seine Eltern werden alleinig verantwortlich gemacht.
„Das Elternhaus ist überfordert…“, „Der braucht einfach Grenzen…“, „Das passt hier einfach nicht mehr…“, „Sie ist nicht beschulbar...", „Das ist ist ein Arschlochkind...", „Er muss jetzt einfach mal lernen...", „Sie müssen mehr mit dem Kind üben...", „Sie muss sich mehr Mühe geben...", „Sowas habe ich noch nie erlebt...", „Die anderen schaffen es doch auch..."
Sätze, die alle die gleiche Funktion haben: Sie entlasten kurzfristig, aber sie verschleiern die eigentliche Ursache.
Zwischen Anspruch und Realität
Rein rechtlich ist der Auftrag klar: Lehrkräfte sind verpflichtet, individuell zu fördern und inklusive Lernbedingungen zu schaffen. Das steht so in den Schulgesetzen und in der UN-Behindertenrechtskonvention.
Doch die Realität sieht anders aus.
Der Lehrkräftemangel ist massiv, Klassen sind zu groß, multiprofessionelle Teams fehlen, und in vielen Ausbildungen spielt Wissen über Neurodivergenz oder das autonome Nervensystem praktisch keine Rolle.
Dazu kommt: Viele Lehrkräfte sind selbst chronisch gestresst. Einige bringen eigene neurodivergente Muster mit, die sie nie reflektieren konnten oder maskieren.
Das System arbeitet am Limit und projiziert den Druck nach unten. Auf die, die am wenigsten dafür können: die Kinder.
Der blinde Fleck: Überforderung als Tabu
Es ist menschlich, an die eigenen Grenzen zu kommen. Aber es ist gefährlich, diese Grenzen nicht zu benennen.
Denn solange Lehrkräfte ihre eigene Überforderung nicht reflektieren, sondern externalisieren, bleibt alles wie es ist. Kinder werden zum „Problemfall“. Eltern zum „Störfaktor“. Und das System kann so tun, als liefe alles „nach Plan“.
Doch das ist eine Illusion, und sie hält uns davon ab, die eigentlichen Probleme anzupacken: fehlendes Wissen, fehlende Strukturen, fehlende Unterstützung.
Echte Verantwortung bedeutet, Missstände sichtbar zu machen
Verantwortung übernehmen heißt nicht, immer alles zu schaffen.
Verantwortung übernehmen heißt auch, klar zu benennen, wenn man es nicht mehr schafft.
Lehrkräfte könnten – und sollten – Überlastungsanzeigen schreiben, wenn sie ihren gesetzlichen Bildungsauftrag unter den gegebenen Bedingungen nicht erfüllen können. Nicht aus Trotz, sondern aus professioneller Integrität.
Denn das wäre ein starkes Signal: „Wir nehmen unseren Auftrag ernst. Und genau deshalb weisen wir darauf hin, dass wir ihn unter diesen Umständen nicht erfüllen können.“
Das würde den Druck dorthin lenken, wo er hingehört – auf die politische Ebene.
Dorthin, wo strukturelle Lösungen entstehen müssen:
- kleinere Klassen,
- bessere personelle und räumliche Ausstattung,
- fundierte Weiterbildung zu Neurodiversität, Trauma, Stress und Nervensystem,
- gelebte Selbst- & Co-Regulation.
Nur wer Verantwortung übernimmt, kann Wandel anstoßen
Solange Lehrkräfte schweigen und Überforderung im Kind verorten, bleibt der Status quo bestehen. Kinder werden weiterhin sanktioniert, Eltern beschuldigt, Lehrkräfte erschöpft. Und das System reproduziert seine eigene Dysregulation.
Aber:
Sobald Überforderung benannt wird, entsteht Bewegung.
Sobald Wissen über das Nervensystem Einzug in Schule hält, entsteht Verständnis.
Und sobald PädagogInnen beginnen, sich selbst zu regulieren, anstatt Kinder zu disziplinieren, entsteht Beziehung.
Und genau da beginnt Bildung.
- Auf Twitter teilen
- Auf Facebook teilen
- Auf LinkedIn teilen
- Auf Pinterest teilen
- Per E-Mail teilen
- Link kopieren
Rebekka Emersleben Newsletter
Treten Sie dem Newsletter bei, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten